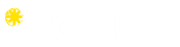Immer häufiger altern und sterben Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, in denen sie oftmals jahrzehntelang leben. Viele von ihnen erreichen inzwischen eine ähnlich hohe Lebenserwartung wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Daher sehen sich Mitarbeitende dieser Einrichtungen vielfach mit Situationen konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet sind…
Ein zweistöckiges Gebäude am Ortsrand, umgeben von einem Garten mit einer Linde, dazwischen ein paar Bänke, eine Schaukel, gepflasterte Wege, ein Kräuterbeet, vor der Eingangstür eine üppig blühende Kletterrose. Was auf den ersten Blick an eine Art Jugendherberge in Kleinformat erinnert, entpuppt sich als Einrichtung der besonderen Wohnformen. So heißen Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe seit 2020. Eine besondere Wohnform für besondere Menschen.
Dabei wollen sie das gar nicht sein. Besonders. Sie wollen sein wie alle. Wollen Teil der Gesellschaft sein wie alle anderen. Wollen selbstbestimmt leben, Entscheidungen treffen, wollen mitreden, gefragt werden, wollen ernst genommen und verstanden werden. Auch am Ende ihres Lebens. So wie jeder von uns.
In der ersten Etage von Haus Wiesengrund leben sechs Frauen und vier Männer zwischen fünfundzwanzig und sechzig Jahren. Sie alle sind von Geburt an kognitiv beeinträchtigt, einige schwer, andere leichter. Einige von ihnen haben zusätzlich ein körperliches Handicap. Sie sind so individuell wie die Kräuter draußen im Garten, aber geeint durch die Tatsache, dass ihnen ein selbständiges Leben ohne Unterstützung nicht möglich ist.
Hier, in Haus Wiesengrund, fühlen sie sich gut aufgehoben, begleitet, in ihren persönlichen Bedürfnissen unterstützt, gefördert und als vollwertiger Teil der Wohngemeinschaft wahr- und ernstgenommen. Sie spüren: Hier ist es normal, verschieden zu sein.
Im letzten Zimmer am Ende des hellen Korridors lebt Tine. Seit achtzehn Jahren. Sie ist neunundvierzig, ein Energiebündel mit einem Gesicht voller Sommersprossen. Wenn sie sich über etwas freut, sprühen Funken in ihren grünen Augen, und wenn sie etwas komisch findet, kann sie lachen, bis sie einen Schluckauf hat. Tine hat nie gelernt zu sprechen, doch sie kann Bedürfnisse, Schmerzen, Hunger, Durst, Wohlbefinden und Unwohlsein nonverbal zum Ausdruck bringen.

Noch nie ist ein Bewohner, eine Bewohnerin in Haus Wiesengrund verstorben
Tine hat Krebs. Massiver Befall beider Lungenflügel. Metastasen an der Wirbelsäule und den Oberschenkelknochen. Der Befund ist inzwischen so umfassend, die Krankheit so weit fortgeschritten, dass die vor einem Jahr begonnenen Chemotherapien und Bestrahlungen nichts mehr ausrichten können.
Das Team reagiert bestürzt. Wie versteinert sitzen sie beisammen – drei Heilerziehungspflegerinnen, zwei Erzieherinnen, ein Krankenpfleger, eine Auszubildende, ein Praktikant, eine Küchenhilfe. Die Hoffnung auf Heilung, auf ein Wunder, hat sie zwölf Monate lang getragen. Sie weigern sich, zu akzeptieren, dass Tine sterben wird und wissen gleichzeitig, dass sich das Fortschreiten der Erkrankung nicht aufhalten lässt. Der Krebs ist nicht nur ein Teil von Tine, sondern vom gesamten Gruppenalltag geworden. Bösartig, dominant, gegenwärtig, Tag und Nacht. Noch nie hatte jemand in Haus Wiesengrund Krebs. Noch nie ist ein Bewohner, eine Bewohnerin hier verstorben. Tine wird die erste sein.
Ängste und Unsicherheiten tauchen auf, setzen sich fest in ihren Köpfen und Herzen.
Kann Tine weiter bei uns bleiben?
Können wir sie angemessen begleiten?
Werden die Schmerzen stärker?
Wird sie Atemnot haben?
Wird sie ersticken?
Was, wenn sie nicht mehr essen und trinken kann?
Wer kann uns helfen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen?
Muss sie verlegt werden, wenn wir die Versorgung nicht mehr leisten können?
Wohin dann mit ihr?
In ein Pflegeheim?
Unsere Tine in ein Pflegeheim?
Schnell wird deutlich, dass niemand Tine in ein Pflegeheim geben möchte. Sie soll die noch verbleibende Lebenszeit dort verbringen, wo sie gelebt hat, wo sie sich zuhause fühlt, umgeben von Menschen, die sie kennt und die sie kennen. Sie und ihre Besonderheiten. Die sie verstehen, obwohl sie kein Wort spricht. Die wissen, dass sie für ein gekochtes Ei mit süßem Senf durchs Feuer gehen würde, und beim Läuten der Kirchenglocken die Hände faltet, weil sie sie sich dabei an ihre Oma erinnert, bei der sie aufwuchs und die schon viele Jahre auf dem Friedhof begraben liegt.
Sie geben ihr Bestes und stoßen doch immer wieder an ihre Grenzen. Krankenpfleger Tom kennt jemanden vom Palliativdienst. Er nimmt Kontakt auf, erfährt, dass eine Verordnung vom Hausarzt nötig ist, damit das Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung in die Pflege eingebunden werden kann. Tom spricht mit dem Hausarzt, der sich zunächst sträubt, schließlich aber, weil Tom beharrlich bleibt, eine entsprechende Verordnung ausstellt. Die Pflegekräfte und eine Ärztin des Palliativdienstes sind rund um die Uhr erreichbar, um Tines Schmerzen, Atemnot und Unruhe medikamentös zu lindern. Eine große Sicherheit für das Team.
Anni von der zweiten Etage, eine Bewohnerin mit Trisomie 21, macht es sich zur Angewohnheit, täglich Tines Zimmer aufzusuchen. So wie früher. Wie vor der Krankheit. Anni und Tine sind befreundet. Befreundet, ohne jemals ein Wort miteinander gewechselt zu haben.
Anni steht an Tines Bett und schaut. Summt. Nimmt den einohrigen Plüschteddy, der seinen Platz neben Tines Kopfkissen hat, wiegt ihn in ihren Armen und legt ihn auf Tines Bauch. Dann geht sie. Um am nächsten Tag erneut zu kommen, zu schauen, zu summen, den Teddy zu wiegen und auf Tines Bauch zu legen.
Müssen wir mit Anni sprechen?
Was sollen wir ihr sagen?
Woher wissen wir, was sie vom Sterben versteht?
Und wie sagen wir den anderen, dass Tine sterben wird?
Niemand hat Antworten, alle sind unsicher. Auch die Schwestern des Palliativdienstes wissen keinen Rat. Sie verabreichen Medikamente zur Schmerzlinderung und gegen Luftnot, zeigen atmungserleichternde Lagerungen – wissen aber nicht, wie man mit beeinträchtigen Menschen kommuniziert und ob man ihnen die Wahrheit zumuten kann. Einige von Tines Mitbewohnern fordern sich schließlich die längst überfälligen Antworten ein.
Kann Tine gar nicht mehr aufstehen?
Warum isst sie nicht mehr mit uns?
Mag sie keine Eier mit süßem Senf mehr?
Wann geht das vorbei mit der Krankheit?
Einige aus dem Team antworten ausweichend. Andere beschließen, lieber nichts als etwas Falsches zu sagen. Jedes Wort könnte eine Lawine auslösen. Eine Lawine aus weiteren Fragen. Aus Worten, aus Tränen, aus Hilflosigkeit und Schrecken. Das will niemand. Tines Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sollen geschützt werden, keine Angst haben müssen. Der Tod soll ihnen nicht zu nah kommen. Noch nicht.
Wir wissen nicht, wann Tine wieder bei uns am Tisch sitzen kann, sagt Tom vorsichtig. Er fühlt sich nicht gut damit, wissend, dass sein Versuch, einen Bogen um das Thema zu machen, langfristig keinen Bestand haben wird. Er sollte etwas anderes sagen. Die Wahrheit. Er ringt nach Worten. Wie spricht man über schwere Dinge in leichter Sprache?
Seine pädagogisch ausgebildeten Kollegen haben schon im Rahmen ihrer Ausbildung gelernt, mit beeinträchtigen Menschen zu kommunizieren, sie kennen Wege und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme auch bei jenen, die nicht sprechen und nur unzureichend verstehen können. Doch jetzt ist alles anders. Jetzt sind sie sprachlos. Versteinert. Stumm.
Tine stirbt – wäre die einzig richtige Antwort. Niemand bringt es über die Lippen. Auch Tom nicht.
Zehn aufeinanderfolgende Tage besucht Anni ihre Freundin Tine, die ihre Augen nicht mehr öffnet. Die nicht mehr lächelt, nicht mehr mit ihr lacht, die nicht mehr ihre Hand nimmt, nicht mehr mit ihr schaukeln geht, nicht mehr mit ihr draußen auf der Bank unter der Linde sitzt und Schokolade mit ihr teilt.
Jedes Mal greift Anni nach dem Teddy, wiegt ihn und legt ihn auf Tines Bauch.

Ihr Flüstern heiligt den Augenblick des Abschiednehmens
Tine stirbt an einem Sonntag. Vormittags. Das Fenster ist geöffnet, der Wind spielt leicht in den Vorhängen, die Vögel singen in der Linde.
Tom ruft alle in den Gruppenraum. Er weiß, dass er klare Worte finden muss. Das Benennen von Dingen schafft Realität.
Tine ist eingeschlafen… wäre verwirrend. Tine ist gegangen… ebenso. Sie würden es nicht verstehen. Sie würden fragen. Wann wacht sie wieder auf? Wann kommt sie zurück?
Er sieht sie alle der Reihe nach an. Sie sind ganz still. Sogar die Lauten sind leise. Es ist, als wüssten sie es längst.
Tine ist gestorben.
Es sagt sich leichter als befürchtet.
Kommt sie jetzt auf den Friedhof zu ihrer Oma?
Wer darf jetzt auf ihrem Platz sitzen?
Dann brauchen wir keinen süßen Senf mehr.
Darf ich ihre CDs haben?
Tom nimmt sie ernst. Die skurril anmutenden Gedanken, Fragen, die Tränen der einen, das Übergehen zur Tagesordnung der anderen. Er antwortet, sorgt für Klarheit. Findet den Bogen zurück zu Tine.
Sie dürfen zu ihr. Sich verabschieden. Nicht alle wollen. Einige sind unsicher, tasten nach Toms Hand, suchen seine Nähe. Sie flüstern, als sei es verboten, in Anwesenheit von Tines leblosem Körper laut zu sprechen. Ihr Flüstern heiligt den Augenblick des Abschiednehmens an Tines Bett.
Später geht Tom hinauf zu Anni.
Tine ist gestorben. Möchtest du noch einmal zu ihr, Anni? Auf Wiedersehen sagen?
Anni kämmt ihre Puppe. Sieht nicht mal auf. Sie summt ihr Lied. Legt den Kamm weg und wiegt die Puppe in ihren Armen. Tom verlässt leise das Zimmer.
Er weiß, Anni hat sich längst von Tine verabschiedet.