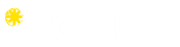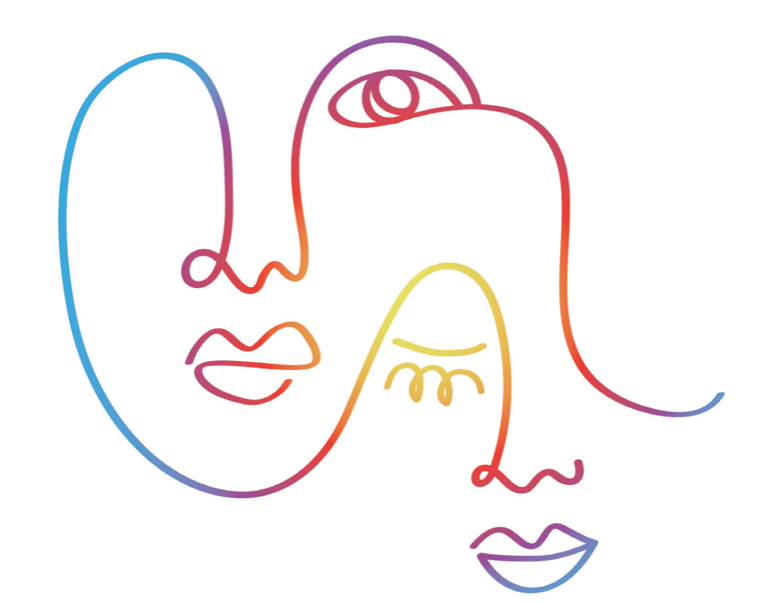Ich habe sie alle gesehen, wissen Sie, wirklich alle. In der ersten Reihe stand ich immer dabei und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Leute damals abgegangen sind, bei den Konzerten von Miles Davis und Chet Baker, na und ich auch, das weiss ich noch genau, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so, dass Jazz so beliebt ist, aber ich, ich habe sie alle noch gesehen und daran erinnere ich mich heute noch ganz genau.”
Der alte Mann und der Jazz
Ich bin in den Genuss gekommen, eine kostenlose Vorlesung über die Entwicklung des Jazz von seinen frühen Anfängen bis zum heutigen Zeitpunkt besuchen zu können. Der Dozent ist ein recht betagter stattlicher Mann, groß und dünn, schulterlanges noch sehr volles strohweißes Haar, die Stimme rauchig, passend zum Thema. Der Vorlesungsort: Ein anonymer Raum, weiße Wände, die Einrichtung spartanisch, ein Bett, ein Tisch, ein Schrank, zwei Stühle. Wir befinden uns auf einer Palliativstation im Norden Berlins, ich bin Musiktherapeutin, er der Patient, besser: der Mensch, den ich für kurze Zeit begleiten darf.
Es ist der vierte Tag in Folge, an dem ich ihn besuche und mir seine Geschichten über die großen Jazzmusiker seiner Zeit anhöre.
Am ersten Tag hatte er mich wieder weggeschickt. Er habe kein Interesse an Musiktherapie, er wüsste nicht, was ich für ihn tun könne. Ich dürfe jedoch gerne am nächsten Tag nochmal kommen, vielleicht sei es da anders. Am zweiten Tag präsentiert er mir stolz seine Plattensammlung, die habe er sich gestern Abend extra noch von seinem Sohn mitbringen lassen, um mir zu zeigen, wie wichtig ihm Musik sei, aber nein, Musiktherapie brauche er nach wie vor nicht, er habe ja seine Platten. Die schauen wir uns dann auch gemeinsam an. Und dann fängt er an zu erzählen.
Von den Anfängen des Jazz in Deutschland und wen er alles live gesehen hatte. Welche Band welchen Schlagzeuger/Sänger/Trompeter wann ausgetauscht und wie sich das auf die Musik ausgewirkt hatte. Er erzählt mir vom Keller im Rathaus Köpenick in Berlin, einer seiner Lieblingsadressen für Jazz und er erzählt mir von den Konzerten von Louis Armstrong&The All Stars im alten Friedrichstadtpalast, bei dem er, in der ersten Reihe saß und gejubelt hatte.
Es ist nicht immer leicht ihm zu folgen, er springt inhaltlich zwischen verschiedenen Musikern und Bands hin und her. Aber es fasziniert mich, ihm zuzuhören, ich verspreche ihm, wieder zu kommen und das tue ich dann auch. Den dritten Tag und den vierten Tag und dann noch eine weitere Woche 1-2 Stunden täglich. Dann wird er in ein Hospiz entlassen und ich sehe ihn nie mehr wieder. Den rauen Klang seiner Stimme allerdings und die Begeisterung, mit der er über den Jazz und seine Musiker spricht, habe ich auch heute noch im Ohr – drei Jahre später.
Muss ich jetzt etwa singen?”
Diese Episode meiner Arbeit auf einer palliativen Station ist nicht unbedingt ein Standardbeispiel für unsere Arbeit als Musiktherapeuten. Aber sie zeigt so einige Aspekte auf, mit denen wir uns täglich beschäftigen.
Die erste Abwehr eines neuen Patienten zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen.
“Ach, muss ich jetzt etwa singen?!” oder “ich bin total unmusikalisch, ich wurde auch immer aus dem Chor geworfen” sind gängige Sätze, die ich unzählige Male gehört habe. Viele verbinden mit dem Thema Musik (insbesondere dem aktiven Musizieren) sehr festgefahrene Vorstellungen und eine meiner Aufgabe als Musiktherapeutin liegt darin, diese Vorstellungen gleich zu verstehen und zu hinterfragen. Gemeinsam schauen wir dann, was die Musik in all ihrer Größe und mit all ihren Ebenen und Elementen für ihn tun kann.
Denn die Therapie mit Musik ist so vielfältig wie die Musik selbst – und wie der Mensch selbst. Das ist auf der Palliativstation nicht anders als in anderen Fachbereichen der Musiktherapie.

So vielfältig wie die Musik – und das Leben
Wir benutzen die Elemente Rhythmus, Melodie und Klang. Wir können auf der physiologischen Ebene arbeiten, zum Beispiel mit Klängen, die mit Hilfe einer Körpertambura und Klangschalen direkt auf den Körper einwirken. Oder wir bewegen uns auf der psychologischen Ebene, wenn wir uns den Gefühlen widmen, die durch Musik ausgelöst werden können oder wenn wir in eine aktive Improvisation gehen, um die ein oder andere Emotion genauer zu betrachten und am Ende auch wieder kontrollieren zu können. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Musikrichtungen. Wir können Musik hören in der Therapie (rezeptiv) oder gemeinsam Musik machen (aktiv). Und natürlich singen wir auch viel, Volkslieder, Popsongs, Schlager oder Circle Songs.
Und dann gibt es auch das Gespräch, das in der Begleitung von Sterbenden eine große Rolle einnimmt, wie das anfangs beschriebene Beispiel zeigt. Dieser leidenschaftliche Jazzliebhaber brauchte keine Improvisation und kein gemeinsames Singen, was er ursprünglich mit dem Begriff Musiktherapie verbunden hatte. Was er aber brauchen konnte, war ein Gespräch und vor allem: mein Zuhören.
Im Rückblick kann ich es noch besser sehen, dass es bei ihm um den Aspekt der Begegnung ging und um die Zeit, die ich ihm widmen konnte, ohne auf die Uhr zu schauen. Ich würde gerne behaupten, dass es auch um mein Fachwissen im Bezug auf Jazz ging, das wäre allerdings gelogen, denn im Vergleich zu ihm war ich absoluter Laie. Allenfalls konnte ich zwischendurch damit trumpfen, dass ich ihm Ausschnitte des Livekonzert von Louis Armstrong 1965 auf YouTube zeigte. Aber es war auch nicht nötig, viel zu wissen, denn die Möglichkeit, seine Erfahrungen mit mir zu teilen, hatte ihm eine besondere Aufgabe gegeben, die eine weitere Funktion dieser Therapie erfüllte: eine Rückschau auf sein Leben, sein Wissen und seine ganz persönliche musikalische Biografie. Die Jazzmusik war sein roter Faden und all das Revue passieren zu lassen, verlieh seinem Leben den Sinn, den er brauchte, um abschließen zu können.
Dvořák, Wunder und Stille
Somit sehe ich meine Arbeit auf einer Palliativstation nicht als eine Arbeit mit dem Tod, sondern als eine Bestätigung des gelebten Lebens. Der Tod mag zwar allgegenwärtig sein, jedoch geht es in den Stunden, die ich mit den Menschen dort verbringe, um all das, was ihr Leben lebenswert gemacht hat. Es geht um das Hören der Mondarie aus der Oper Rusalka von Antonin Dvořák, die man mit dem Partner so oft bei einem Glas Wein genossen hatte oder um das gemeinsame Singen von ‚Wunder gibt es immer wieder‘, wobei unausgesprochen bleibt, wie das Wunder aussehen darf, das einen erwartete. Und glücklicherweise geht es auch immer wieder um Humor. Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an eine Patientin, die sich als Klingelton auf ihr Handy die Melodie von dem Film ‘Spiel mir das Lied vom Tod’ gezogen hatte, um sich jedes Mal königlich über die pikierten Gesichter ihrer Angehörigen zu amüsieren, wenn es in deren Anwesenheit mal wieder klingelte.

Manchmal sind wir Musiktherapeuten auch nur Musiker. Eine sehr prägende Erfahrung war für mich, als ich gebeten wurde, auf einer improvisierten Hochzeit zu singen. Die Braut hatte Brustkrebs im Endstadium und wurde auf dem Bett liegend zum Altar in der Krankenhauskapelle gefahren, um ihren Verlobten zu heiraten. Der Klinikseelsorger führte die Zeremonie durch, unter den Gästen saßen neben den Angehörigen auch Schwestern und Pfleger, Ärzte, Sozialarbeiter und die Stationsreinigungskraft. Ich sang auf Wunsch der Braut u.a. ‚Danke‘ von Elif, wohlwissend, dass viele der Anwesenden bald wieder zusammensitzen würde – für die Beerdigung.
Fast jeder Mensch hat Musik auf die ein oder andere Weise im Leben integriert. Manchmal hat das allerdings nicht viel damit zu tun, welcher Aspekt am Ende des Lebens von Nutzen sein kann. Ich habe einmal einen Heavy Metall Schlagzeuger begleitet, der sich in jeder Stunde mit mir eine Klangmeditation mit dem Monochord gewünscht hat.
Ein andermal traf ich einen überzeugten Atheisten an
… wat soll da kommen nach‘m Tod, nüschts, dat sach ick Ihnen!“,
der von mir mehrfach das Lied ‘Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer’ vorgesungen haben wollte, das er aus seiner Kindheit kannte.
Ich denke, am Ende kann so manche Maske fallen gelassen werden. Wenn es um das Sterben geht, habe ich eigentlich noch niemanden erlebt, der nicht dankbar ist über eine nahe, authentische Begegnung mit einem Menschen, der es wirklich gut mit ihm meint und mit ihm zusammen das Lebenswerte im Angesicht des Todes sichtbar macht.
Bis hin zu den letzten Atemzügen. Auch die durfte ich schon begleiten. Am Ende eigentlich nur noch mit vereinzelten Klängen oder mit der Stimme. Je näher wir dem Tod kommen, desto mehr nimmt die Stille Raum ein.
Die Musik ist nun Zeremonie und Ritual und ein Übergang. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr weiter begleiten kann.