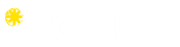In der Buchrubrik Beginnen wir am Ende nimmt Tom Schröpfer Literatur als Startpunkt für die Auseinandersetzung mit den Themen Abschied, Sterben, Tod und Trauer.
Was kann Literatur? Wo hilft sie beim Abschiednehmen? Und welche Themen lassen sich mit ihr verhandeln?
memento mori
… und die unweigerliche Bilanz
Memento mori ist eine wertvolle Erkenntnis. Vielen hilft sie beim Relativieren, beim Einordnen, Zurechtrücken und Neujustieren. Die wirkliche Einsicht, die Erfahrung und das Verständnis dafür endlich zu sein und von endlichen Dingen umgeben zu sein, kann unheimlich erdend wirken. Soweit die eine Seite. Doch was, wenn wir die Medaille umdrehen? Könnte das, was für die einen erdend und ermutigend ist, andere ängstigen und ihnen den Boden unter den Füßen entziehen?
Mal ehrlich: wenn uns diese Erkenntnis durchdringt – entwickeln wir Kräfte oder geht uns der Arsch auf Grundeis?
Nicht immer geht die Bewusstwerdung der Endlichkeit der Dinge mit uneingeschränkt positiven Begleitgefühlen einher. In der Literatur haben mich immer besonders die Zwischentöne interessiert, das Ausloten des eigenen Verhältnisses zur Sterblichkeit, zwischen Demut und Selbstbewusstsein. Häufig finden sich solche Suchen in Büchern, die von Krebserkrankungen erzählen. Es ist das Hadern dieser Menschen, das Ringen um eine Haltung zum Leben im Sterben, das mich in ihren Schriften immer wieder mitgenommen hat. Sie konnten nicht anders, als memento mori zu begreifen – und zwar in beide Richtungen.
Christoph Schlingensief

Christoph Schlingensief zum Beispiel hat in seinen Aufzeichnungen zu seiner Krebserkrankung unheimlich viel Wut und Verzweiflung festgehalten. Kurz nach seiner Diagnose nahm er sich ein Diktiergerät zur Hand und begann die Gespräche mit sich selbst und Gott festzuhalten. Das unweigerliche Ziehen einer Bilanz, das memento mori meines Erachtens auf die eine oder andere Weise immer mit sich bringt, führt auch bei Schlingensief dazu, noch einmal alles auf den Prüfstand zu stellen. Was war bis hierher? Wo stehe ich? Was will ich noch und was braucht es in der Welt? Und danach?
Schlingensief, der ohnehin immer wieder sehr drastische, teilweise rohe und aggressive Inszenierungen für seine Kunst gewählt hatte, geht mit der Welt und vor allem seinem Glauben, hart ins Gericht.
Im einen Moment analysiert er seine Religion und findet beispielsweise Trost in dem Gedanken nie punktgenau wissen zu können, wann der eigene Tod eintritt. Für ihn macht das die Utopie aus. Erst mit der genauen Kenntnis über Zeit und Ort des Todes, würde alles Vorgelagerte kalkulierbar, würde es seine Unvorhersehbarkeit verlieren, wäre somit ganz und gar berechenbar und damit – tot. Erst die Unverfügbarkeit der Welt könne uns neugierig auf sie machen, nur dann könnten wir von ihr überrascht werden, ehrliche Zugewandtheit aufbringen und dadurch lebendig sein.
Dann wieder flucht er und klagt an, teils diffus vor sich hin, teils direkt and Gott adressiert, teils auch nur an Praktiken und Auslegungen seiner Religion, die seiner Meinung nach eher dazu beitragen, dass die Menschen sich ängstigen und klein werden, statt Kraft im Glauben zu finden und zu wachsen.
Und natürlich stellt er die Frage nach dem Sinn. Nach Art und Weise der Umgangsformen miteinander. Nach Möglichkeiten des Weitermachens und auch nach dem, was bleibt.
So wie ich Schlingensiefs künstlerisches Schaffen kennengelernt habe, hätte es mich gewundert, wenn er eine andere Antwort aus seiner Bilanz formuliert hätte, als: intensiv weitermachen, mit etwas mehr Klarheit und die wirklich wichtigen Dinge zu Ende bringen. Die Ideen und ersten Umsetzungen zum Operndorf Afrika sind da nur ein Beispiel von einigen Aktionen, die ihm in seinen letzten Jahren noch gelangen. Bemerkenswert finde ich sein Fazit, das er zwischen all dem Austeilen und Schwanken formuliert. Nicht umsonst trägt die Buchform seiner aufgezeichneten Gespräche den Titel So schön wie hier, kanns im Himmel gar nicht sein!.
Wolfgang Herrndorf

Genista – eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25652790
Dieser Wunsch und diese Wut etwas schaffen zu wollen, ganz besonders dann, wenn uns die Endlichkeit bewusst wird, scheint mir eng verwoben mit der Idee, eine eigene Persönlichkeit zu sein. Wolfgang Herrndorf hat, kurz nachdem bei ihm ein unheilbarer Hirntumor diagnostiziert wurde, begonnen einen Blog* zu führen. Die Einträge sollten zunächst seine Nächsten auf dem Laufenden halten, doch relativ schnell stellte sich heraus, dass Herrndorf hier mehr als ein Logbuch verfasst. Er bearbeitet seine Zustände. Bald ist klar, dass das Schreiben ihm Halt und Kontur gibt, aber nicht nur das Schreiben. Seine Antwort auf die unweigerliche Bilanz lautet so, wie auch die Buchveröffentlichung seines Blogs heißen wird: Arbeit und Struktur. Nicht lange nach seiner Diagnose schließt Herrndorf die Arbeit an seinem Roman Tschick ab und veröffentlicht wiederum ein Jahr später Sand. An beiden Büchern hatte er zuvor schon Jahre gearbeitet, dennoch schien ihn seit der Erkrankung eine neue Schaffenskraft gefunden zu haben. Er traf schnellere Entscheidungen, probierte nicht unzählige Varianten eines Satzes aus und sah so sein Werk wachsen.

von Wolfgang Herrndorf ©rowohlt
Das selbst formulierte Mantra Arbeit und Struktur wirkt auf mich wie das Setzen einer Kontur, in einer Situation, in der er sich selbst immer mehr entgleitet. Das Verfassen seiner Literatur stelle ich mir für ihn als intensive Erfahrung von Selbstwirksamkeit vor. Als Beweis der Existenz. Beim Verfolgen seiner Worte zeigt sich mir ein Mensch, der selbstironisch mit großer Ernsthaftigkeit dem nachgeht, was ihn antreibt und lebendig macht.
Im Verlauf des Blogs* finden sich mit der Zeit Lücken von mehreren Tagen, in denen er nichts geschrieben hat. Zusammen mit manchen stenografisch wirkenden Einträgen und den Beschreibungen der sich addierenden Symptome seiner Erkrankung, wirkt der Blog noch mehr wie ein Abbild seines inneren Empfindens. Selten habe ich beim Lesen Lücken und Ungeschriebenes derartig präsent erlebt. In ihrer Abwesenheit wirken diese Passagen wie klaffende Wunden.
Dass Herrndorf sich selbst zum Ende seines dreieinhalb jährigen Krankheitsverlaufs nicht zu allgemeinen Weisheiten hat hinreißen lassen oder in Phrasen abgerutscht ist, und dass er bei der selbst auferlegten Strenge niemals hart oder verbissen wirkte, hat mich sehr beeindruckt.
Herrndorfs Antwort auf die unweigerliche Bilanz war also das klarere und intensivere Weiterverfolgen bereits formulierter Lebensinhalte. Im Schreiben findet er Wirkung und schafft seine Identität.
Helena Zumsande

von Helena Zumsande
© Ullstein Buchverlage GmbH
Was für Herrndorf das Schreiben war, muss für Helena Zumsande das Singen gewesen sein. In ihrem Buch Solange ihr mein Lied hört, berichtet die Anfag Zwanzigjährige vom Moment kurz nach ihrem ersten Chemotherapieblock bis zur Verwirklichung ihres Traums. Helena bekommt nach zweijähriger Krankheitsgeschichte Magenkrebs diagnostiziert und pendelt fortan zwischen Hoffen und Bangen. Auch sie erzählt von verzweifelten Gedanken, möchte nicht einfach so verlöschen und vor allem das Leben einer jungen Frau leben. Zeit verschwenden, sich verlieben… umso bewundernswerter ist es, wie einfühlsam, fast zart, sie ihren Weg beschreibt, was wohl eng an ihre Leidenschaft geknüpft ist.
Kurz nach ihrem ersten Chemoblock, trifft sie sich mit ihrem Onkel in einem von ihm organisierten Tonstudio und interpretiert einen ihrer Lieblingssongs in Studioqualität neu. Die Aufnahme bearbeitet er und veröffentlicht sie einige Zeit später in den sozialen Netzwerken. Zu diesem Zeitpunkt war Helena vom Krankheitsverlauf schon sehr erschöpft. Was folgte, waren unzählige Geschenke der Anerkennung. Helenas Version von John Legends All of Me verbreitete sich rasant und bescherte ihr in kürzester Zeit unheimlich viel Zuspruch. In einem Interview lässt sie fallen, dass sie auch gern Sarah Connors Wie schön du bist singen würde. Wenig später trifft sie Sarah Connor und macht genau das. Die auf Youtube zu findende Aufnahme von Helenas Gesang, ist ein Zeugnis verdichteten Glücks.
Bezogen auf memento mori lässt sich mit Worten kaum besser ausdrücken, was Helenas Moment in jeder Sekunde transportiert und ihrem Buch als Botschaft vorangestellt ist: Tu, was dir am Herzen liegt.
Bilanz ziehen, abgleichen und dann Entscheidungen treffen. Das wäre eine Formel, die alle drei hier beschriebenen Schicksale miteinander verbindet, und angesichts der Komplexität der einzelnen Situationen doch viel zu kurz greift. Dennoch scheint die drastische Vergegenwärtigung der Endlichkeit immer auch die Konzentration und das Besinnen auf Leidenschaften mit sich zu bringen.
Wie wäre es, wenn uns eine solche Perspektive ohne eine persönliche, schwere Krankheitsdiagnose gelänge? Haben wir in unserem Alltag die Möglichkeiten einen solchen Blick einzunehmen?
Sicherlich wäre es schwierig, eine solche Klarheit dauerhaft aufrecht zu erhalten, aber vielleicht können wir die Bedingungen so schaffen, dass uns dieser Gedanke häufiger findet.
Antje Grube

Antje Grube hat in ihrem Buch Wer jammert bleibt draußen die letzten Monate mit ihrer Mutter und einige Zeit danach festgehalten. Die Krebserkrankung und den Tod ihrer Mutter beschreibt sie als Beginn eines Wendepunkts in ihrem Leben, der auch sie zurück zum Schreiben und damit zu einer liegengebliebenen Leidenschaft geführt hat. Insofern lese ich dieses Buch weniger als einen Bericht einer Tochter, die ihre an Krebs erkrankte Mutter begleitet, sondern eher als Dokument eines sich findenden Fokus in Antje Grube.
Dieser Fokus scheint mir bei den anderen Texten zwischen den Zeilen stets mitgeschrieben zu sein.
Denn auch wenn ich die einzelnen Schicksale in ihrer Dramatik nicht relativieren möchte, so gehört der Appell, die Dinge noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, um so (zurück) zur Leidenschaft zu finden, eben auch zu diesen Geschichten.
Vielleicht hilft dieses zeitweise Innehalten und Selbstverorten ein Stück memento mori in unseren Alltag zu integrieren.
Disclaimer: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Verweise sind sogenannte Provision-Links. Wenn du auf so einen Verweislink klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wr von deinem Einkauf eine geringe Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.