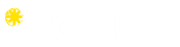Diese Kieswege unter den mächtigen Bäumen bin ich schon einmal abgeschritten, vorbei an den hochgewachsenen Rhododendren. Gut dreizehn Jahre mag das her sein.
Der 1890 eröffnete Stadtfriedhof ist enorm weitflächig, ungefähr neunmal so groß wie der Louvre. Hier befinden sich ungefähr 17.000 Grabstätten. Es gibt alte Mausoleen, ein Kriegsgräberfeld mit symmetrischen Reihen weißer Kreuze. Ehrengräber, denkmalgeschützte Steine, eine Kindergedenkstätte voller Blumen und bunter Windräder.
Jetzt ist alles grün, die Vögel zwitschern. Es ist so friedlich. Wir, mein Mann und ich, sind auf der Suche nach einem Grab. Seinem Grab. Irgendwo hier hinten links muss es sein nach meiner Erinnerung. Nicht direkt beim Seerosenteich. Oder doch? Unsere Schritte knirschen.
Es muss jetzt etwa dreizehn Jahre her sein, als Herr N., mein erster Therapeut, verstarb. Die Zusammenarbeit mit ihm hat mir sehr viel ermöglicht. Nicht nur mir, auch meinem Mann, der mit mir gemeinsam nach dem Grab sucht. Dankbar spüren wir gemeinsam den Therapie-Ergebnissen nach: Der Erhalt unserer Beziehung, das Aufarbeiten alter Traumata, emotionales „Nachreifen“, das Erlernen einer gesunden Paar-Kommunikation, bis der Weg frei war zu unserem Wunschkind. Fast unglaublich, aber wahr: Als mir mein Therapeut dies mitteilte mit den Worten: „Frau Hille, sie sind soweit.“, sollte noch am selben Abend meine Reise als Mutter beginnen.
Wir verdanken diesem Mann so viel. Niemals werde ich seine blitzend blauen Augen und seine Güte mir gegenüber vergessen. Als begnadeter Therapeut mit jeder Menge Methodenwissen stimmte dazu noch die Chemie zwischen uns beiden. Eine Begegnung auf Augenhöhe, voller Freundlichkeit und Wertschätzung.
Ein dreiviertel Jahr arbeitete ich in der Therapie intensiv zweimal die Woche an meiner Befreiung aus diesen schrecklichen Depressionen und Belastungen der Vergangenheit. Dann war der Genesungsprozess nach meinem schweren Burnout so weit fortgeschritten, dass ich wieder in Teilzeit arbeiten konnte. „Mittwochs ein freier Tag, das ist für Sie ein guter Rhythmus, dann können Sie runterkommen, neue Kräfte tanken, bevor es mit dem zweiten Teil der Woche weitergeht.“
Wir biegen um eine Ecke. Der Kiesweg führt uns in ein heckenumsäumtes, rechteckiges Gräberfeld. Ja, so in etwa sieht das Bild meiner Erinnerung aus, als wir sein Grab das erste Mal besuchten. Damals hatte ich mir vorab vom Friedhofsmanagement die Lage geben lassen. Diesmal sind wir nur den Spuren unserer Erinnerung gefolgt, die uns zwischen all diesen Gräbern gegen jede Wahrscheinlichkeit zur richtigen Stelle bringt.
Ich bitte meinen Mann, ein Foto von mir zu machen, neben dem Grabstein, als Erinnerung. Ich pflücke ein paar Gänseblümchen und zwei Hornveilchenblüten, die ich pressen will. Etwas mitnehmen vom Jenseits in diese Welt.
Rückblick auf die Therapie
Herr N. hat mich immer als Mensch gesehen mit einer unsterblichen Seele, nicht als Diagnose. Meine bipolare Erkrankung, die ich zu der Zeit seit über einem Jahrzehnt aus meinem Bewusstsein verdrängt hatte, kam während der Therapie nicht zur Sprache. Die Bipolare Störung ist mit rund 4 Millionen Betroffenen in Deutschland übrigens recht weit verbreitet.[1] Bekannt waren uns beiden während der Therapie aber nur meine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und deren Ursachen. Und doch konnte in dieser Zeit so viel Heilsames geschehen.
Herr N. begleitete mich ebenfalls therapeutisch während der Schwangerschaft mit unserem Sohn, ich blieb psychisch stabil. Mein Mann und ich freuten uns auf unser Wunschkind, wir waren eifrig mit dem „Nestbau“ beschäftigt.
Geburt unseres Sohnes
Doch dann erfolgte die traumatische Geburt und nichts war mehr wie zuvor. Da wir nicht um meine bipolare Erkrankung wussten, war uns auch nicht bekannt, dass eine Geburt für eine Frau das höchste Lebenszeitrisiko darstellt, erstmals an der Bipolaren Störung zu erkranken.[2] Oder – existiert diese bereits wie bei mir – einen weiteren Schub im Rahmen der Erkrankung zu erleiden.[3]
So verstanden wir überhaupt nicht, was plötzlich mit mir los war: Ich stand völlig neben mir, wurde immer gestresster, konnte nachts nicht mehr schlafen. Mit der Versorgung unseres Babys war ich überfordert. Ja, ich hatte sogar Angst, auch nur kurze Zeit mit unserem Sohn allein zu bleiben. So konnte es nicht weitergehen. Ich musste in eine psychiatrische Klinik. Diagnose: Bipolar, akut manisch-verzweifelt. Meine Welt zerbrach.

Sechs Wochen Psychiatrie
Sechs Wochen verbrachte ich dort. Sechs Wochen voller Verzweiflung, sechs Wochen betäubt von starken Medikamenten. Sechs Wochen, in denen ich nicht wusste, wie es für uns als Familie weitergehen würde, ob wir eine Chance hätten, jemals gemeinsam wieder glücklich zu werden. Sechs Wochen, in denen ich mich von Atemzug zu Atemzug hangelte. Irgendwann begann ich, die nie zuvor religiös gewesen war, zu beten: „Lieber Gott, beschütze mich und meine Familie. Amen.“ Und mir schien, dass diese Worte an Gott die Last auf meinen Schultern ein klitzekleines bisschen leichter machten. Doch ich erwartete nichts und wagte kaum zu hoffen.
Aber es waren auch sechs Wochen, in denen sich die Oberärztin, Frau Dr. K., einmal die Woche eine Stunde Zeit nahm, uns die Bipolare Störung zu erklären. Mit welchen Erwartungen durfte mein Mann mir künftig begegnen und mit welchen nicht? Damit hat sie dazu beigetragen, unsere Ehe zu retten. Doch vor allen Dingen war mir schon wenige Tage nach dem Start meines Klinikaufenthaltes klar, dass ich zu 100 Prozent mit den Ärzten und Therapeuten zusammenarbeiten und ja, dass ich künftig Managerin meiner Erkrankung werden wollte. Diese schnelle Erkenntnis, von nun an mit einer erheblichen psychischen Erkrankung umgehen zu müssen, gelang mir nur deshalb, weil ich mir der Verantwortung für unseren Sohn vollauf bewusst war. Ihm wollte ich Mutter sein.
Start ins Familienleben
Mein Mann verlängerte auf Rat der Ärztin seine Elternzeit auf ein halbes Jahr. Nach sechs Wochen wurde ich aus der Klinik entlassen. Ich war so unsicher. Unsicher in jeder Hinsicht. Gegenüber unserem Baby, dass ich so vorsichtig an- und auszog, als wäre es eine zerbrechliche Puppe. Immer sollte mein Mann dabei sein, dessen routinierte Handgriffe ich mir dann nach und nach abschaute. Aber auch gegenüber meinem Mann war ich sehr verunsichert. Meine größte Angst war, er könnte für immer den Respekt vor mir verloren haben. Schließlich hatte ich mich selbst verloren. Doch diese Angst konnte er mir zum Glück nehmen.
Schritt für Schritt gelang es uns, mit unserer Liebe und dem neuen Verständnis füreinander doch noch zu der Familie zusammen zu wachsen, die wir uns so sehr ersehnt hatten.
Dank an meinen Therapeuten
Es mag ein halbes Jahr nach der Geburt gewesen sein, dass wir ein Fotobuch mit Babybildern unseres Sohnes für meinen Therapeuten bastelten. Darin von mir und meinem Mann jeweils ein Brief, in dem wir uns bei ihm mit persönlichen Worten bedankten. Er freute sich sehr darüber. Für dieses Timing bin ich im Nachhinein unendlich dankbar.
… und dessen plötzlicher Tod
War es Zufall, dass mir seine Todesanzeige beim Zeitunglesen sofort in die Augen sprang? Denn nur wenige Wochen später wurde er, gerade Mitte oder Ende 50, mitten aus dem Leben gerissen. Tot, vermutlich durch Herzinfarkt, genau haben wir es nicht erfahren. Er hatte immer sehr viel gearbeitet, dabei Espresso getrunken und geraucht. Ein absoluter Genussmensch und Workaholic. Womöglich nicht die besten Voraussetzungen für ein langes Leben.
Aber zusammen mit seiner therapeutischen Gabe Voraussetzung dafür, dass er im Leben vieler Menschen so viel Gutes bewirkt und einen echten Unterschied gemacht hat. Ein Mensch, der wahrhaftig ein Mehr an Zuversicht, Liebe und Licht in diese Welt gebracht hat.

„Danke für alles, Herr. N.“
Ich stelle es mir oft vor, wie Sie von oben auf einer Wolke sitzend, den Kopf auf die angewinkelten Arme abgestützt, auf mich herabschauen. Voller Wohlwollen und Freude darüber, wie gut doch mir mein Leben mit all den täglichen Herausforderungen durch die bipolare Erkrankung gelingt. Trotz der mittlerweile erfolgten Verrentung aus gesundheitlichen Gründen, trotz eines Behinderungsgrades von 50, trotz Pflegegrad 2.
Ich sehe Sie zu mir freundlich herunterlächeln, voller Güte, den Daumen der rechten Hand nach oben gereckt. Dann Ihr Spruch „super Bärchen“, den ich noch so gut kenne, mit ihrer Stimme im Ohr…
Voller tiefster Zuneigung und ewiger Dankbarkeit
Ihre Nora Hille
[1] Bräunig, Peter: Leben mit Bipolaren Störungen. Manisch-depressiv: Antworten auf die meistgestellten Fragen, 3. Auflage, Stuttgart 2018, S. 15. Laut der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS) ist in manchen Studien sogar von bis zu 5 Millionen Betroffenen in der Gesamtbevölkerung die Rede. Quelle: Homepage der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V., https://dgbs.de/bipolare-stoerung/bedeutung/ (Zugriff: 23. Juni 2023).
[2] Müller, Thomas: Gefährdete Mütter. Erst das Baby, dann bipolare Störung. Online veröffentlicht unter ÄrzteZeitung am 22. Mai 2013. Quelle: https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Erst-das-Baby-dann-bipolare-Stoerung-291341.html (Zugriff: 23. Juni 2023).
[3] Vgl.: Online-Artikel „Bipolare affektive Störung.“ Verfasser: Embryotox in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Anke Rohde und Prof. Dr. med. Sarah Kittel-Schneider. Quelle: https://www.embryotox.de/erkrankungen/details/ansicht/erkrankung/bipolare-affektive-stoerung/ (Zugriff: 23. Juni 2023).