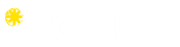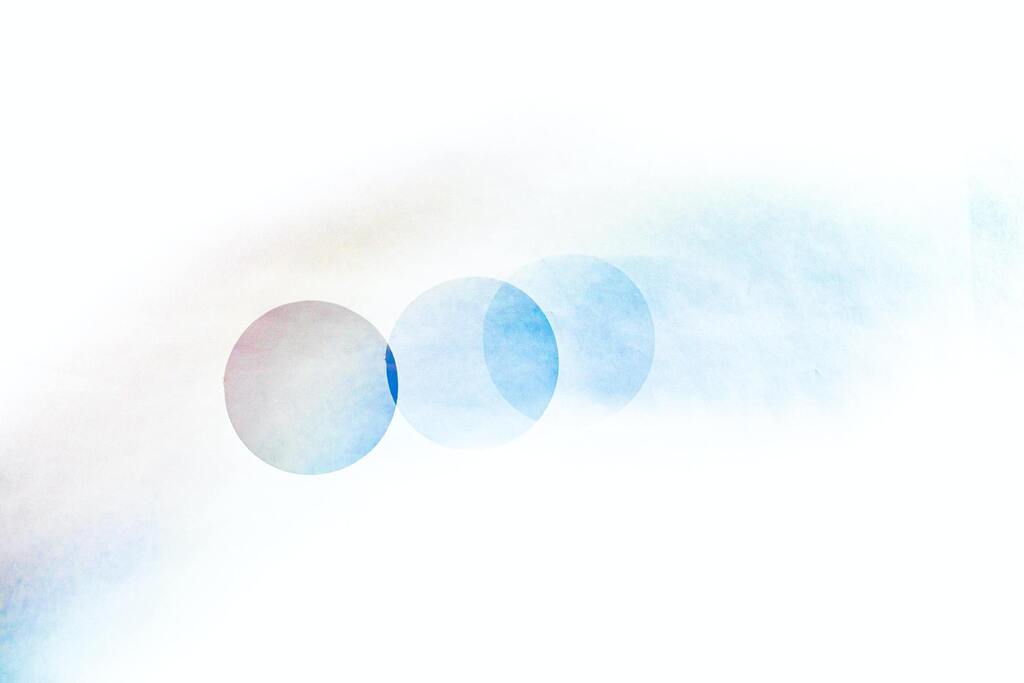Kann ich als Trauerbegleiterin Menschen bei oder nach einem Verlust begleiten, sie sogar ermutigen sich von ihren verstorbenen Lieblingsmenschen zu verabschieden, ohne es selbst je getan zu haben? Wie kann ich völlig selbstverständlich über Tod und Sterben reden, aber auf die Frage, wie der Tod denn nun wirklich aussieht, keine Antwort haben? Ich hatte bereits tote Menschen auf Fotos oder in Filmen gesehen, na klar, aber das war nicht das Gleiche. Viele dieser Fragen, gingen mir während meiner Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin und auch eine Zeitlang danach immer wieder durch den Kopf.
Über viele Jahre hatte ich diese Lücke, rund um den Tod, in meinem Kopf mit eigenen Vorstellungen gefüllt. Diese lösten teils bedrückende Gefühle in mir aus und auch eine, wie sich im Nachhinein herausstellte, unbegründete Angst schlich sich ein, inklusive schrägem Kopfkino. Würde der Tod die Menschen so sehr verändern, dass ich sie vielleicht nicht mehr erkennen oder sie sogar unheimlich aussehen würden? Warum sonst sagte man mir von Kindheit an, du sollst deinen geliebten Menschen in Erinnerung behalten, wie er war, statt mich zu ermutigen mich zu verabschieden?! Bis ins Erwachsenenalter hielt sich bei mir der Eindruck, dass andere Menschen aus meinem Umfeld, aufgrund ihrer Erfahrungen, besser wüssten was mir guttut und so ließ ich andere für mich entscheiden. Der frühe Verlust meiner Kinder während der Frühschwangerschaft und später dann die Ausbildung zur Trauerbegleiterin eröffneten mir eine neue Sichtweise auf den Tod. Ich verstand, warum ein bewusster Abschied beim Begreifen hilft und wie heilsam es für den weiteren Trauerweg sein kann. Meine Angst wurde kleiner, als ich in meiner Aushilfstätigkeit für eine Bestatterin erstmals Kontakt mit toten Menschen hatte, mit einem zu früh geborenen Kind und mit einer Person in meinem Alter. Stück für Stück verlor der Tod seinen Schrecken und ich gewann die Sicherheit, dass ich für die Begegnung mit verstorbenen Lieblingsmenschen gewappnet bin.
… sogar ein VATER UNSER haben wir gemeinsam gebetet
Vor einem Jahr, am Ende eines längeren Krankenhausaufenthalts, als meine Oma ihre Kräfte verließen, trat sie ihre letzte Reise an. Für mich war sofort klar, dass ich bis zum Schluss und darüber hinaus bei ihr sein wollte. Ich wollte bei ihr im Krankenhaus sein und diesmal sollte mich nichts davon abhalten. Am Tag vor ihrem Tod begleitete ich sie auf der Intensivstation. Ich hielt ihre Hand, streichelte ihren Arm und befeuchtete ihre Lippen. Oma war noch in der Lage zu sprechen, sogar ein VATER UNSER haben wir gemeinsam gebetet. Zum Glück schlief Oma immer wieder kurzzeitig ein und hat gar nicht bemerkt, dass ich vor Aufregung wenig textsicher war. Auch jetzt lässt mich diese wertvolle Erinnerung noch schmunzeln. Ihr Körper wurde zunehmend kraftloser, nur meine Hand, die hielt sie fest. Auch ihre Wahrnehmung wurde schwächer und von Zeit zu Zeit fragte Oma, ob ich noch da wäre. Sie wollte nicht allein sein zwischen all den piepsenden Apparaten, wirkte fast ein wenig ängstlich wie ein kleines Kind. Ich konnte sehen, wie Oma sich Stück für Stück vom Leben verabschiedete.
… ich strich zum allerersten Mal über Omas inzwischen weißgraue Haare
Der Anruf kam in aller Frühe. Ich war bereit. Auf dem Weg ins Krankenhaus spürte ich Erleichterung darüber, dass Oma nach einem beschwerlichen letzten Weg nun endlich ruhen konnte. Gleichzeitig war ich traurig darüber, dass ein Mensch, der mein ganzes Leben wie selbstverständlich da war, plötzlich fehlt und ich fragte mich, ob ich es nicht zu selbstverständlich genommen hatte. Eine friedliche Ruhe durchflutete ihr Zimmer. Oma lag, bis zum Oberkörper zugedeckt und die Hände übereinander gefaltet, im Bett. Auf dem Schränkchen brannte eine Kerze. Omas Seele war für mich noch spürbar im Raum. Eine Hand legte ich ihr auf den Brustkorb, vielleicht auch ein bisschen, um zu überprüfen, ob Omas Herz nun wirklich nicht mehr schlägt. Mit meiner anderen Hand strich ich zum allerersten Mal über Omas inzwischen weißgraue Haare. Ich kannte meine Oma bis zu diesem Krankenhausaufenthalt nur mit braunen, zuletzt gefärbten, Haaren. Ihr Aussehen war ihr immer sehr wichtig gewesen. Ich gab ihr einen Kuss auf die kalte Stirn und flüsterte: „Gute Reise und grüß Opa von mir!“ So sah er also aus, der Tod. Oma sah für mich, auch mit weißgrauen Haaren und ohne Gebiss, immer noch aus wie Oma. So ganz ohne Grusel. Fast schon verwunderlich, dachte ich. Ihre Haut war zwar kalt, aber fühlte sich an wie am Tag zuvor. In diesem Moment schloss sich die Lücke in meinem Kopf und in meinem Herzen. Plötzlich begriff ich, dass diese Menschen immer unsere Lieblingsmenschen bleiben, und dass unser Herz sie immer erkennen wird. Was bleibt sind wundervolle Erinnerungen und Dankbarkeit. Durch die Begegnung mit meiner toten Oma habe ich alles, was danach kam völlig neu und anders wahrgenommen als bei all den Lieblingsmenschen, die bereits vor Oma verstorben waren und von denen ich mich nicht persönlich verabschiedet hatte.

Oma und ich hatten, ehrlich gesagt, kein sehr enges und inniges Verhältnis im Leben. Bei meiner Geburt war sie noch sehr jung, gerade mal sechsundvierzig Jahre alt, drei Jahre älter als ich es jetzt bin und sie wollte noch keine Oma werden. Aber mit diesen letzten Tagen, den Stunden an ihrem Bett, dem Abschied von meiner toten Oma, machte sie mir, vielleicht ohne es zu wissen, ein großes Geschenk. Was im Leben oft nicht möglich war, war am Lebensende wichtig und unverzichtbar. Endlich konnte ich meinen Platz einnehmen. Und noch ein Geschenk hat meine Oma mir gemacht. Oma war, manche würden sagen schwierig, andere würden sagen ehrlich. Wenn ihr etwas nicht passte und auch wenn es unser spontaner Besuch war, dann sagte sie das und ließ es uns auch spüren. Heute würde ich sagen, eine taffe Frau, die für vier Kinder gesorgt hat und trotzdem gelernt hat auf ihre Bedürfnisse zu achten. Sie hat mit ihrer Wahrheit nicht hinterm Berg gehalten. Nein, wirklich nicht. Auch dann nicht, wenn sie damit vielleicht manchmal jemanden vor den Kopf stieß oder schwach und kraftlos in ihrem Bett lag. In Zukunft werde ich das Leben öfter mal durch ihre Augen sehen.